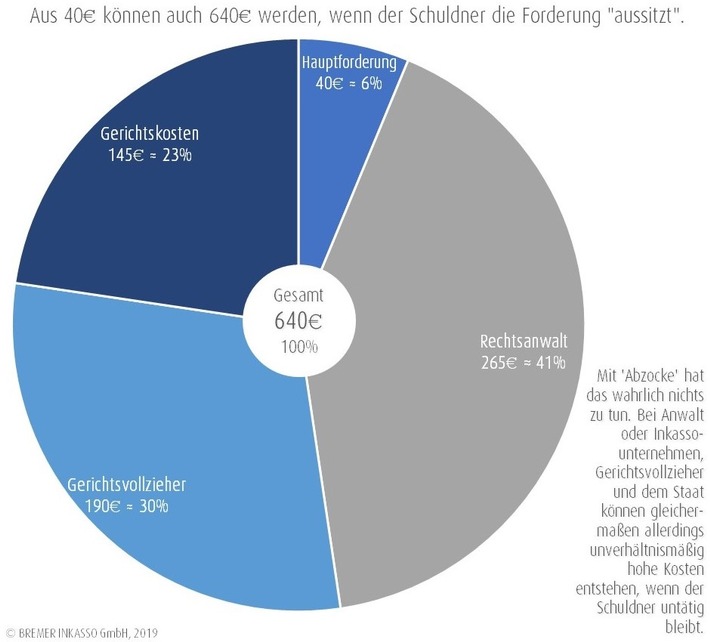
Inkasso wird in der heutigen Zeit oft an den Pranger gestellt. Mit
Inkasso wird ein Milliardengeschäft verbunden. Berichte über
schwammige Gesetze, mangelnde Aufsicht und überhöhte Gebühren machen
die Runde. Ja, es ist gar die Rede davon, dass „Inkasso“ dafür
verantwortlich ist, dass Schuldner nicht von ihren Schulden
herunterkommen. Schnell sind Beispiele zur Hand, in denen Forderungen
von 40,00 EUR durch Inkasso auf rund 700,00 EUR ansteigen. Das
Ergebnis der so aufgemachten „Rechnung“ ist ganz einfach: Inkasso ist
an allem schuld. „–Schuldige– und –einfache Rechnungen– sind heute
gern genommen – es ist am Ende aber etwas –zu kurz gesprungen–„,
erklärt Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso GmbH.
„Leider versuchen manche Schuldner, die Forderung einfach
auszusitzen, verursachen dadurch Aufwand und Kosten, und wundern sich
später über die hohe Gesamtforderung.
Das ist mit jemandem zu vergleichen, der immer wieder den
Warnhinweis im Display seines Wagens ignoriert, dass er in die
Werkstatt muss, weil etwas nicht in Ordnung ist, und der meint, das
wird schon nicht so schlimm sein. Und der sich dann aber irgendwann
vom Mechaniker anhören muss, dass der Schaden, wäre er gleich in die
Werkstatt gekommen, leicht und günstig zu beheben gewesen wäre, sich
nun aber, durch das –Aussitzen–, massiv vergrößert hat und somit eine
Reparatur sehr umfangreich und enorm teuer wird. Das ist dann nicht
die Schuld des Autos, der Werkstatt oder gar des Mechanikers – das
hat sich der Autofahrer ganz alleine zuzuschreiben.“
Durch die Einschaltung eines Anwalts entstehen Kosten, wie bei
jeder Dienstleistung. Die Kosten steigen mit jeder Maßnahme, die der
Anwalt zur Realisierung der Forderung zusätzlich ergreifen muss, je
länger der Schuldner eine Forderung aussitzt. Diese anfallenden
Kosten gelten gleichermaßen auch für die Beauftragung eines
Inkassobüros.
Auftraggeber der Inkassounternehmen dürfen nämlich nach bereits
geltendem Recht vom Schuldner nur solche Kosten erstattet verlangen,
die auch bei Einschaltung eines Rechtsanwalts entstanden wären. Die
Grundlage der Gebührenberechnung ist hier der Gegenstandswert der
Forderung. Der niedrigste, gesetzlich festgelegte Gegenstandswert ist
–bis 500 EUR–. Für eine Kleinstforderung von 40 EUR fallen also die
gleichen Gebühren an wie für eine Forderung in Höhe von 499 EUR.
Nachfolgend erläutert Bernd Drumann einige Maßnahmen sowie die
dafür vom Gesetzgeber vorgesehenen Gebühren/Pauschalen.
Beispiel 40 Euro Hauptforderung: Welche Anwaltsgebühren entstehen
hier in der Regel?
„Rechtsanwälte rechnen meist nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) ab. Dort sind u. a. die
unterschiedlichen abrechenbaren Gebühren sowie deren Höhe
tabellarisch aufgelistet zu finden. Die Höhe der jeweiligen Gebühren
richtet sich zumeist nach dem Gegenstandswert einer Forderung bzw.
nach dem Streitwert. Bei dem Einzug einer Forderung kommen zu den
40,00 Euro Hauptforderung in der Regel eine sogenannte 1,3
Geschäftsgebühr, 20% (von dieser Gebühr, max. 20,00 Euro)
Auslagenpauschale sowie die Mehrwertsteuer (MwSt) auf den
Gesamtbetrag hinzu (die MwSt jedoch nur dann, wenn der Auftraggeber
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist). Das heißt in Zahlen: Bei
einer Forderung von –bis 500 Euro– (niedrigster gesetzlich
festgelegter Gegenstandswert) kommen 58,50 Euro (1,3 Geschäftsgebühr)
sowie 11,70 Euro (20% von 58,50 Euro) Auslagenpauschale = 70,20 Euro
zzgl 19% MwSt (13,33 Euro), also 83,53 Euro Gesamtkosten auf den
Schuldner zu. Diese Kosten hat er grundsätzlich zu erstatten. An den
Anwalt muss der Schuldner daher 123,53 EUR (Kosten und
Hauptforderung) zahlen.
Nach Zahlung von Kosten und Hauptforderung: Fall für Schuldner
erledigt?
„Ja, in der Regel ist der Fall erledigt, wenn die Zahlung der vom
Anwalt angeforderten Summe fristgerecht geleistet wurde. Mit der
sofortigen Zahlung des geforderten Betrages oder einer unverzüglich
mit dem Rechtsanwalt getroffenen Zahlungsvereinbarung ist der
Schuldner gut beraten. Ein mitunter sehr teures gerichtliches Mahn-
und Vollstreckungsverfahren hat er sich so erspart.“
Schuldner knapp bei Kasse. Rückzahlung in Raten möglich?
„Ja! Eine Ratenzahlungsvereinbarung (auch über einen kleineren
Betrag) ist möglich und allemal besser, als zu versuchen, die Sache
„auszusitzen“. Allerdings rechnet ein Rechtsanwalt gemäß RVG für eine
Zahlungsvereinbarung eine zusätzliche Gebühr ab. Ihm steht eine 1,5
Einigungsgebühr, 20 % von dieser Gebühr (max. 20,00 Euro) als
Auslagenpauschale sowie die Mehrwertsteuer (s.o.) zu. Als
Auslagenpauschale dürfen jetzt aber nur noch die restlichen 8,30 EUR
angesetzt werden, die von den max. 20 EUR nach Abzug der bereits in
der Berechnung der Gesamtkosten (ohne Zahlungsvereinbarung)
geforderten 11,70 EUR (s.o.) übrig sind. Abzurechnen sind daher 67,50
EUR (1,5 Einigungsgebühr) sowie 8,30 EUR = 75,80 EUR zzgl. 19 % MwSt
(14,40 Euro) = Gesamtkosten 90,20 EUR. Der Schuldner hat jetzt die
40,00 EUR Hauptforderung, die 83,53 EUR Gesamtkosten (vor
Zahlungsvereinbarung) und die 90,20 EUR Gesamtkosten für die
Zahlungsvereinbarung, also 213,73 EUR zu zahlen.
Warum muss eine solche Vereinbarung überhaupt Geld kosten?
„Jedes Verfahren, das nicht vor Gericht landet, belohnt der
Gesetzgeber. Jede außergerichtliche Erledigung entlastet die Justiz.
Der Gesetzgeber hat es daher ausdrücklich geregelt, dass der Anwalt
für seine Bemühungen um die außergerichtliche Erledigung als Anreiz
eine zusätzliche Gebühr erhält.
Die Vereinbarungen selbst dürften in der Regel auch bei einem
Anwalt schon so vorbereitet sein, dass deren Erstellung keinen
größeren Aufwand darstellt. Allerdings ist der Anwalt naturgemäß
gehalten, auch zu überwachen, ob die Raten tatsächlich
vereinbarungsgemäß gezahlt werden. Ist das nicht der Fall, wird der
Anwalt den Schuldner an die Zahlung erinnern. Zudem verursacht jede
Buchung zeitlichen Aufwand sowohl beim Zahlungsein- als auch beim
Zahlungsausgang. Das alles ist Teil einer Dienstleistung, die kostet.
Und manche dieser Zahlungsvereinbarungen laufen über Jahre. „
Können solche Kosten für Zahlungsvereinbarungen bei einem Anwalt
auch mehrfach entstehen?
„Auch das ist möglich und gar nicht einmal ungewöhnlich. Nehmen
wir an, der Anwalt hat vorgerichtlich eine Zahlungsvereinbarung
getroffen. Der Schuldner hält diese jedoch nicht ein und reagiert
auch nicht auf die anwaltlichen Zahlungsaufforderungen. Schließlich
führt der Anwalt darauf hin das gerichtliche Mahn- und
Vollstreckungsverfahren durch und, um die Vollstreckung abzuwenden,
ersucht der Schuldner den Anwalt nun erneut um Ratenzahlung.“
Was passiert, wenn der Schuldner die Sache bis hier aussitzt und
sich gar nicht kümmert?
„Auf jeden Fall sollte man m. E. den Schuldner damit nicht
–durchkommen– lassen und die Maßnahmen zur Realisierung der Forderung
jetzt frustriert stoppen. Inkonsequenz spricht sich bei Schuldnern
schnell rum. Aber abgesehen davon wird der Rechtsanwalt
selbstverständlich (realistischerweise) vor der Beantragung eines
gerichtlichen Mahnverfahrens geprüft haben, ob über den Schuldner
irgendwelche harten Negativdaten im Schuldnerregister eingetragen
sind. Sollte es harte Negativdaten wie –Gläubigerbefriedigung
ausgeschlossen—- –Nichtzahler– oder den Eintrag –Verweigerung der
Vermögensauskunft– geben, kann es ratsam sein, es bei einem
vorgerichtlichen Verfahren zu belassen. Und sollte letztlich das
–Ende der Fahnenstange– aller Möglichkeiten erreicht sein, kann ein
realistischer Schlussstrich vor weiterem Schaden bewahren.“ „Sind
jedoch keine harten Negativdaten feststellbar, wird der Rechtsanwalt
in der Regel das gerichtliche Mahnverfahren einleiten. Die
Einigungsgebühr hat sich der Schuldner vielleicht erspart, doch wird
es ab jetzt teurer als der Abschluss und die Einhaltung der
Zahlungsvereinbarung. Bei einem Rechtsanwalt entstehen für die
Vertretung im gerichtlichen Mahnverfahren Kosten: eine sogenannte 1,0
Verfahrensgebühr für die Beantragung des gerichtlichen Mahnbescheides
und eine 0,5 Verfahrensgebühr für die Beantragung des
Vollstreckungsbescheides, 20% (von dieser Gebühr, max. 20,00 Euro)
Auslagenpauschale sowie ggf. die Mehrwertsteuer auf den Gesamtbetrag
Das heißt in Zahlen: Bei einer Forderung von –bis 500 Euro– kommen
45,00 EUR (1,0 Verfahrensgebühr) sowie 22,50 EUR (0,5
Verfahrensgebühr) sowie 13,50 EUR (20% von 67,50) = 81,00 EUR zzgl
19% MwSt (15,39 EUR) = 96,39 EUR Gesamtkosten auf den Schuldner zu.
Das Gericht berechnet dem Anwalt zudem 32,00 EUR Gerichtskosten, die
der Anwalt dem Schuldner ebenfalls belastet. Das Verfahren schlägt
damit mit 128,39 EUR zu Buche.
Zu zahlen wären also jetzt die 40,00 EUR Hauptforderung, die
vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 83,53 EUR sowie die Kosten
des gerichtlichen Mahnverfahrens in Höhe von 128,39 EUR, wovon aber
die Hälfte der vorgerichtlichen 1,3 Geschäftsgebühr, also 34,81 EUR
inkl. MwSt. in Abzug zu bringen sind. Es bleiben 217,11 EUR.“
Ganz bitter für den Schuldner: Anwalt erhebt sofort Klage
„Es kann sein, dass der Rechtsanwalt nach der 1.
Zahlungsaufforderung sofort Klage vor dem Zivilgericht erhebt. Für
den Schuldner ist das extrem bitter. Hier entscheidet der
Verfahrensverlauf über die endgültige Höhe der Anwalts- und
Gerichtskosten. Kommt es zur mündlichen Verhandlung und im Anschluss
zu einem Urteil, entstehen in der Regel an Kosten insgesamt: 2,5
Anwaltsgebühren (1,3 Verfahrensgebühr und 1,2 Terminsgebühr), also
112,50 EUR. Auch hier kommt wieder die Auslagenpauschale von 20,00
EUR dazu sowie ggf. die MwSt. Die Anwaltskosten betragen also 157,68
EUR. Dazu sind Gerichtskosten in Höhe von 105,00 EUR fällig. Das
Verfahren schlägt so mit 262,68 EUR Kosten zu Buche (vorausgesetzt,
der Schuldner nimmt sich nicht selbst ebenfalls einen Anwalt). Dazu
kommen die vorgerichtlichen Anwaltskosten von 83,53 EUR, von denen
allerdings wieder 34,81 EUR als Anrechnungsbetrag abzuziehen sind.
Das ergibt stolze 311,40 EUR zzgl. 40,00 EUR ursprüngliche
Forderung/Hauptforderung = 351,40 EUR.“
Ab jetzt drohen auch Kosten für die Zwangsvollstreckung, kümmert
sich der Schuldner weiterhin nicht
„Eine Standardmaßname aus dem Bereich der Forderungspfändung
könnte sein: Eine Lohn- oder Kontenpfändung. Diese löst ggf. jeweils
20,00 EUR Gerichtskosten und eine 0,3 Verfahrensgebühr in Höhe von
19,28 EUR Anwaltskosten inkl. Auslagenpauschale und MwSt aus. Dazu
kommen Zustellungskosten in Höhe von rund 40,00 EUR, die der
Gerichtsvollzieher im Namen der Staatskasse einzieht, also gesamt
rund 80,00 EUR.“
Ist die Forderungspfändung erfolglos, kann die Beauftragung des
Gerichtsvollziehers folgen
„Hier kann der Antrag auf Sachpfändung gestellt werden. Die
Anwaltskosten belaufen sich auf 19,28 EUR (wie oben). Dazu kommen
Gerichtsvollzieherkosten von rd. 30,00 EUR, gesamt also rund 50,00
EUR. Weitere Kosten entstehen für das Verfahren auf Abnahme der
Vermögensauskunft (früher –Offenbarungseid–). Der Anwalt kann bei dem
Gegenstandswert von 40,00 EUR (unser Beispiel) hierfür weitere 19,28
EUR abrechnen, und beim Gerichtsvollzieher kommen rund 60,00 EUR
zusammen. Und wenn dann der Schuldner – was häufig vorkommt – auf die
Ladung des Gerichtsvollziehers hin nicht erscheint, ist der
Rechtsanwalt gehalten, Haftbefehl zu beantragen und den Schuldner
vorführen zu lassen. Anwaltskosten gibt es hierfür nicht, aber die
Gerichtsvollzieherkosten können mit rund 60,00 EUR zu Buche schlagen.
Dazu kommen Gerichtskosten in Höhe von 20,00 EUR. Zusammen haben wir
dann für die Einschaltung des Gerichtsvollziehers ca. 210,00 EUR.
Je nach dem, für welches Gerichtsverfahren sich also der Anwalt
entscheidet (Klage oder Mahnbescheid), hat der Schuldner nun 290,00
EUR zzgl. 217,11 EUR, gesamt rund 510,00 EUR, oder 290,00 EUR zzgl.
351,40 EUR, und somit rund 640,00 EUR zu –berappen– (siehe Grafik).
Hat der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger die Vermögensauskunft
übersandt, muss der Rechtsanwalt prüfen, ob sich daraus
Pfändungsmöglichkeiten ergeben und dann ggf. auch pfänden. Veranlasst
der Anwalt – nach Vorlage des Vermögensverzeichnisses – nur zwei
weitere Maßnahmen der Forderungspfändung, sind wir hier bei weiteren
rund 160,00 EUR. Sind Ermittlungen notwendig, weil der Schuldner
–untertaucht– oder die Tür nicht öffnet, wenn der Gerichtsvollzieher
kommt, oder sich wochentags der Vollstreckung entzieht und nur
sonntags angetroffen wird usw., erhöhen sich die Gesamtkosten extrem,
so dass auch 700,00 EUR Gesamtforderung und mehr mit den Jahren
locker zu erreichen sind.
Für den Forderungseinzug auch einer kleinen Forderung muss der
Schuldner aber dennoch aufkommen?
„Ja, genau. Gemäß §§ 280 Abs. 1 und 2, 286 BGB ist der
Verzugsschaden, also der Schaden, den ein Gläubiger durch den
Zahlungsverzug eines Schuldners erleidet, vom Schuldner zu ersetzen.
Wie sich aus § 4 Abs. 5 RDGEG ergibt, geht der Gesetzgeber davon aus,
dass hierzu auch die Kosten eines Inkassounternehmens gehören können.
Rechtsdienstleister wie Inkassounternehmen oder Rechtsanwälte stehen
mit Rat und Tat zur Seite. Sie prüfen eingehend, ob eine Forderung
berechtigt ist und inwieweit der Einzug erfolgreich sein kann, auf
welchem Wege und mit welchen Mitteln. Vereinbarungsgemäß erbrachte
Lieferungen und Leistungen verdienen ihre vereinbarte, rechtmäßige
Vergütung. Eine offene Forderung ist und bleibt eine offene
Forderung! Mit –Abzocke– hat das wahrlich nichts zu tun. Bei Anwalt
oder Inkassounternehmen, Gerichtsvollzieher und dem Staat entstehen
gleichermaßen allerdings unverhältnismäßig hohe Kosten, wenn der
Schuldner untätig bleibt. Und das ist dann nicht die Schuld des
Gläubigers, des Anwalts oder des Inkassounternehmens, auch nicht die
des Gerichtsvollziehers oder die des Staates. Das hat sich der
Schuldner dann ganz alleine zuzuschreiben.“
Grafik: © BREMER INKASSO GmbH / www.bremer-inkasso.de
Pressekontakt:
BREMER INKASSO GmbH, Eva-K. Möller, Leerkämpe 12, 28259 Bremen, Tel.
+49 (0)421-84106-25, Fax +49 (0)421-84106-21, E-Mail:
moeller@bremer-inkasso.de
Original-Content von: BREMER INKASSO GmbH, übermittelt durch news aktuell